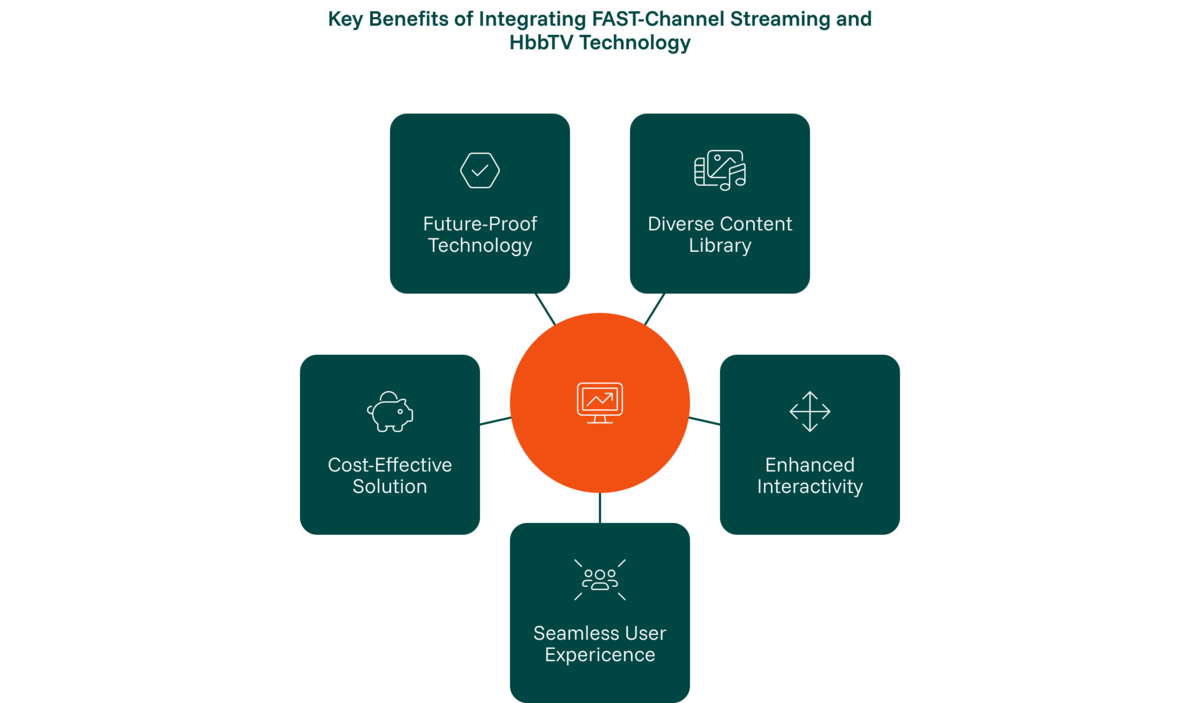Meinrad Müller erzählt von einem besonderen Morgen im Dorf, nachdem der Faschingsdienstag vorbei war. Konfetti lag in den Straßen, doch die Gemeinschaft ging zur Kirche. In der barocken Halle, mit vergoldeten Putten und Engeln an den Wänden, knieten alle nieder – mit oder ohne Restalkohol vom Vortag.
Der Fasching war vorbei, doch die Fastenzeit begann. Bis zum Ostersonntag sollte nichts Fleisch mehr gegessen werden. Die Kinder aßen weniger, nicht aus Mangel, sondern aus Gewohnheit. Die Vorräte waren seit Januar bereit: Im Keller, zwei Meter tief wie ein alter Grabhügel, lag der Presssack mit geräuchertem und eingewecktem Gemüse.
In einem Dorf ohne Fische war das Seelachs in quadratischer Form die Lösung. Der Tante-Emma-Laden „bei der Zenzi“ bot den tiefgefrorenen Fisch an, den die Mutter panierte und mit Kartoffelsalat servierte. Am Aschermittwoch tauchte der Pfarrer in Asche aus dem Vorjahr. Auf jeder Stirn ein kleines Kreuz – eine Erinnerung daran, dass alles endet. „Gedenke, o Mensch, dass du Staub bist und wieder zu Staub wirst“, flüsterte er, beinahe sachlich.
Nach der Messe gingen alle ins Gasthaus „Zur Rosl“. Ein Liter Starkbier half, die Fastenzeit zu durchleben – denn Bier war nicht Fleisch. Das Aschekreuz machte nicht traurig, es schaffte Stille. Und heute, in einer Zeit der Aufhebt, ist ein nüchterner Blick genau das, was wir brauchen.